Künstliche Intelligenz (KI) ist beim Shoppen im Internet allgegenwärtig, der Begriff aber für viele schwer greifbar. Wie würden Sie ihn illustrieren?
CLEMENS WASNER: Empfehlungssysteme sind das perfekte Beispiel dafür, wie KI heute großteils funktioniert. Der Punkt ist, dass KI nicht eine einzelne Technologie ist, sondern Forschungsfeld an der Schnittstelle Mathematik, Statistik, Neurowissenschaften und klassische IT. Unter KI versteht man jetzt vor allem jene Anwendungsgebiete, wo ein System selbstständig aus großen Datenmengen lernt. Im Fall von Empfehlungssystemen - Stichwort Amazon - schaut es sich an, was sich Leute, die ein bestimmtes Produkt gekauft haben, sonst noch ins Einkaufswagerl gelegt haben. Es erkennt Muster.
Ich kaufe online einen Fernseher und bekomme wochenlang weitere Fernseher empfohlen. Nicht sehr smart.
Nein. Aber es gibt eine Vielzahl von Studien über den Wirkungsgrad von KI in den diversen Industriezweigen. Und dieser ist im E-Commerce mit Abstand am höchsten.
Bitte nennen Sie uns weitere Beispiele.
Im Handel kann ich mit KI-Methoden die Nachfrageprognose und damit die Logistik unterstützen. Oder das Energiemanagement in einem Shop, die Diebstahls- und die Zugangskontrolle. Welcher KI-Einsatz in einem Geschäft, glauben Sie, bringt am meisten Umsatz?
Verraten Sie es uns.
Die Erkennung von Pfützen. Sie sorgen – abgesehen von der Sturzgefahr – sofort für einen Umsatzeinbruch nicht nur beim betroffenen Regal, sondern im ganzen Korridor. Pfützen haben eine Signalwirkung für Menschen. Mit einem KI-basierten Bilderkennungssystem lässt sich so etwas überwachen und beheben. Das schlägt sich messbar im Ergebnis nieder. Walmart war hier ein Vorreiter.
Wie nützt KI Konsumenten?
Emphelungsalgorithmen haben aus meiner Sicht schon eine Berechtigung. Eine komplette Anwendung gibt es im Möbelhandel. Das funktioniert so: Ich schwenke mein Smartphone durch den Raum und das System erkennt, ob die Gegenstände, die ich kaufen will, ins Zimmer passen. Ikea hat das vor Kurzem vorgestellt, global beschäftigen sich 20 Start-ups mit dem Thema, auch ein österreichisches. Nike hat begonnen, dass man Sportschuhe online anpassen kann. Anwendungen wie diese werden massiv zunehmen – überall dort, wo es nicht um das Einkaufserlebnis geht.
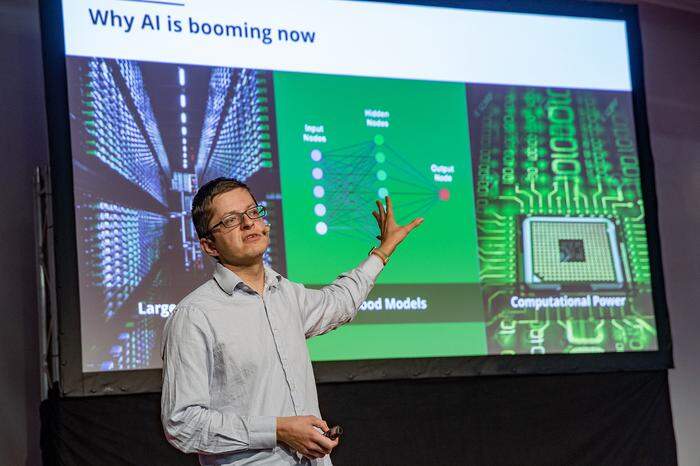
Was heißt das für die Fläche?
Sie wird abnehmen und sie wird sich verändern. Ich nehme China und die Supermarktkette Hema von Alibaba als Beispiel: Das ist ein Hybrid. Auf dem Weg ins Geschäft klicke ich auf dem Smartphone an, was ich kaufen will, das wird vorbereitet und ich kontrolliere es nur noch, sage, was dableibt oder noch dazukommt. Im Geschäft suche ich nur noch die Frischwaren aus, denn das lässt sich schwer digitalisieren. Der Punkt ist, ich brauche mich nicht mehr darum zu kümmern, ob etwa die Kerzen wieder umgeräumt wurden. Diese Art von Konzept gibt es bei uns nicht, aber es würde mich nicht wundern, wenn das zu uns kommt, denn wir sind ja eine kleinteilig organisierte Ökonomie, vor allem im Handelsbereich.
In einem Interview sagten Sie eine Automatisierungswelle bis 2030 voraus. Kostet das Jobs?
Ich glaube nicht daran, dass sich der Personalstand massiv verringern wird. Bei so einer Prognose geht es für mich um das Thema, welche Mehrkosten man verhindern kann bzw. welche zusätzlichen Angebote durch Automatisierung möglich werden. Nehmen wir den Gourmethandel als Beispiel: Ab dem Zeitpunkt, wo ein Regal zu groß wird, wirkt es einschüchternd. Habe ich 500 Weine vor mir zur Auswahl, wird das meine Entscheidungsfindung behindern, das nennt man ein Auswahlparadoxon. In einem automatisierten Markt wird vor so einem Regal künftig eine Person stehen oder ein Sprachassistent bei der Auswahl helfen. Ein anderes banales Beispiel ist die Frage, welche Holzkohle zu meinem Grill passt. Das ist ein Fall für Voice-Commerce und ich glaube stark daran, dass das in die Geschäfte kommt.
Wie ist die österreichische KI-Szene in diesem Zusammenhang aufgestellt?
Unser Ökosystem ist weitaus ausgeprägter als in der Schweiz oder in Bayern. Das Spezielle ist, wir haben kein Pendant zu einer ETH Zürich, es gibt keine österreichische Uni, auf die ich in Tokio oder in Peking angesprochen werde. Und wir haben auch keine gigantisch großen Unternehmen wie Bayer oder BMW. Dennoch haben wir ein extrem lebendiges KI-Ökosystem quer durch alle Branchen. Wir sind in der EU unter den Top fünf.
Sie sind auch einer der Gründer der Plattform AI Austria. Welches Ziel verfolgen Sie damit?
Die Idee ist vor drei Jahren auf einem Podium entstanden. Es gab in Österreich keinen Verein, der das Thema außerhalb der Tech-Bubble kommunizierte, diese Lücke galt es zu füllen. Wir sind zu hundert Prozent nonprofit, also steht jemand von uns auf einer Bühne, stellt er seine eigene Firma nicht vor, das ist eisernes Gesetz. Wir sind in Arbeitsgruppen organisiert, eine zum Beispiel beschäftigt sich mit der Lehre. Die Lehrmaterialien in dem Bereich haben eine sehr kurze Halbwertszeit, da haben wir 40 Institutionen in Österreich zusammengeschlossen. Es organisieren sich auch einige Landesgruppen. Wir sind stark projektmäßig organisiert, das hat die schöne Eigenschaft, es gibt einen Anfang und ein Ende - und dazwischen hoffentlich viel Inhalt.
Fühlt sich die Plattform ausreichend wahrgenommen und unterstützt?
Die Wahrnehmung ist definitiv gegeben, wir waren jetzt auch bei der Erstellung der KI-Strategie Österreichs involviert. Worauf wir aber extrem hohen Wert legen, ist unsere vollkommene Unabhängigkeit. Es ist undenkbar, dass wir von Institutionen wie Wirtschaftskammer oder Stadt Wien, mit denen wir zusammenarbeiten, eine Zuwendung bekommen oder dass sie bei uns Mitglied werden. Das gilt auch für Ministerien. So wie wir organisiert sind, brauchen wir wenig Geld.




